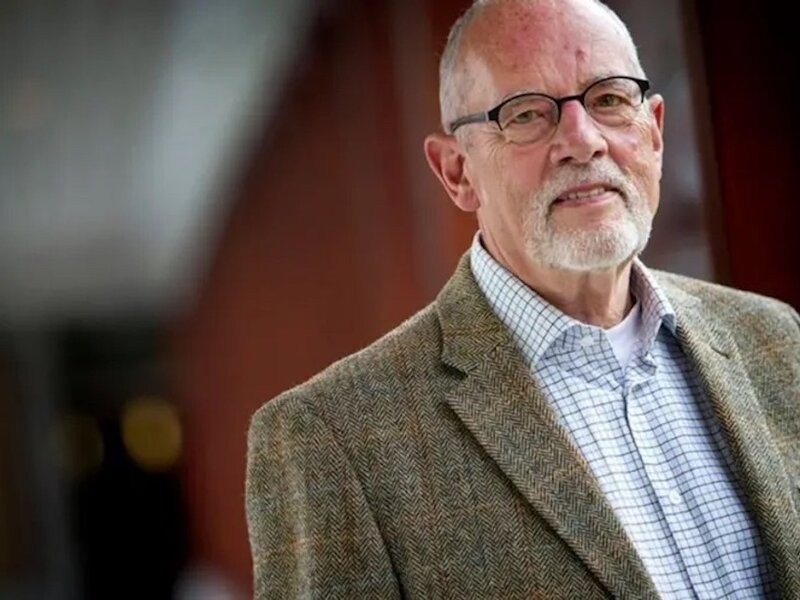Minderheiten in Europa
Hans Heinrich Hansen: Kleine Minderheiten haben keine Chance
Hans Heinrich Hansen: Kleine Minderheiten haben keine Chance
Hans Heinrich Hansen: Kleine Minderheiten haben keine Chance

Diesen Artikel vorlesen lassen.
75 Jahre FUEN: Der Ehrenpräsident aus Nordschleswig blickt zurück und voraus. Er zeichnet trübe Aussichten für die Minderheitenpolitik in Europa – und die deutsche Minderheit in Dänemark.
Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) hat bei ihrem Jahreskongress in Husum in Nordfriesland ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Es wurde aber auch in die Zukunft geschaut. Im folgenden Interview erzählt Ehrenpräsident Hans Heinrich Hansen über seine Zeit in der FUEN – und seinen Blick in die Zukunft der Minderheiten.
Was hat sich in der Minderheitenpolitik verändert seit Anfang der 1990er-Jahre?
„Damals waren wir alle optimistisch. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte Osteuropa auf einmal Priorität. Sehr viele Minderheiten im Osten Europas waren viel schlechter gestellt als wir im Westen. Also war klar, dass wir ihnen dabei helfen mussten, auf dasselbe Niveau zu kommen, wie wir es haben. Die Voraussetzung dafür war ein Lernprozess, bei ihnen, aber auch bei uns. Ich habe immer Wert gelegt auf die Stärkung des Selbstwertgefühls der Minderheiten. Es gibt immer die Tendenz, sie als minderwertig anzusehen; das gilt auch für sie selbst. Es geht darum, dass Minderheiten auf Augenhöhe mit den anderen sprechen.“
Der Optimismus aus jener Zeit ist verflogen?
Spätestens durch den Krieg hat sich alles verändert, woran wir damals geglaubt haben. Die ganzen osteuropäischen Minderheiten waren ja ein belebendes Element auch auf den FUEN-Kongressen, inklusive der großen deutschen Minderheit in Russland. Das ist alles kaputt.
Beim Kongress wurde versucht, einen Ausblick auf die nächsten 75 Jahre der FUEN zu machen. Wie sehen Sie diese Zukunft?
Es muss uns klar sein, dass in zehn Jahren auch schon Schluss sein kann. Ich habe 2014 noch sehr intensiv in Erinnerung. Damals fing es in der Ukraine an, in der Donbass-Region, auch die Krim wurde von Russland besetzt. Wir hatten in Ankara ein Treffen mit der türkischen Arbeitsgemeinschaft in der FUEN. Der Vorsitzende der Krimtataren kam auf mich zu und sagte: Was machen wir denn jetzt? Ich erwiderte: Ich kann nur eines sagen: keinen Krieg, dadurch wird nichts besser. Er hatte Arbeit in Moskau, wohnte da zum Teil, und er konnte nicht mehr dahin zurück. Auch der Zugang zur Krim war ihm versperrt. Und dann erzähle einmal so einem Menschen: Wir sind machtlos, denn unsere Stärke liegt darin, dass wir Probleme auf friedliche Weise zu lösen versuchen. Denn Krieg ist undenkbar für mich.“
2013 wurde in Brixen das Minority SafePack vorgestellt. Wie kam es denn dazu; wer hatte die Idee gehabt?
„Es war 2010 beim FUEN-Kongress in Laibach/Ljubljana, als Gabriel von Toggenburg einen Vortrag hielt und sagte: Es kommt ein neues Instrument in der EU, die Europäische Bürgerinitiative. Und alle spitzten die Ohren. Es war vollkommen klar: Das ist die Richtung.“
Konnte man damals ahnen, dass die EU-Kommission derart abweisend auf das Minority SafePack reagieren würde?
„Nein. Wir waren so naiv zu glauben, dass eine solche Europäische Bürgerinitiative – weil das Instrument ja aus dem Europäischen Parlament kam und von dort initiiert war – rechtlich sicher sei. Eine treibende Kraft waren die Ungarn aus Rumänien. Sie wollten eine Territorialautonomie wie in Südtirol erreichen. Sie haben sehr viel getan und investiert. Vom Optimismus her war das eine einmalige Sache. Die FUEN hat selten so zusammengestanden. Beim Kongress in Brixen 2013, bei dem das Minority SafePack gestartet wurde, war deshalb eine ganz tolle Stimmung. Ich bin da sogar als Sänger aufgetreten.“
Wie das?
„Angezettelt hatten das die Südtiroler FUEN-Vizepräsidentin Martha Stocker und ihre Assistentin Astrid Pichler. Das Motto des Kongresses und des Minority SafePacks hieß ja: ,Du bist nicht allein. Eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas’. Und es gibt doch diesen alten deutschen Schlager mit dem Titel ,Du bist nicht allein’. Da sagte ich: Dazu überlege ich mir etwas. Und dann setzte ich mich im Hotelzimmer hin und machte einen Text zu dem Schlager. Und weil meine Vorredner recht lange geredet hatten, hatte ich mit den wenigen Sätzen des Schlagers vollen Erfolg. Da hat der damalige Südtiroler Landeshauptmann Luis Durnwalder ganz schön geguckt bei der Veranstaltung auf dem Domplatz.“
Der Optimismus verflog aber schnell.
„Zwei Monate später kam die Absage der EU-Kommission mit der Begründung, das Anliegen liege völlig außerhalb der Kompetenz der EU. Über meine Kontakte gelang es mir, ein Gespräch mit dem damaligen Kommissar Frans Timmermans zu bekommen. Er hat mir dann klar erklärt, was die Gründe sind, und gesagt, die Ablehnung sei vollkommen legal. Wir haben dennoch entschieden, gerichtlich dagegen vorzugehen.“
Die Kommission bleibt bei ihrer Ablehnung.
„Unser Rechtsberater Frank de Boer hat am Anfang bei der Anfechtung dieser Ablehnung eine Riesenarbeit geleistet. Wir haben dann den Rechtsprofessor Ernst Johanssonn aus Kiel gefunden, einen großen Anhänger der Idee der Europäischen Union, der sich vor Gericht sehr für unseren Fall eingesetzt hat. Die Gerichte haben uns dann ja auch bescheinigt, dass unser Anliegen vollkommen in Ordnung ist.“
Der Fall ist mittlerweile in der letzten Instanz beim Europäischen Gerichtshof und wird voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres entschieden. Es ist zu befürchten, dass das Urteil nicht positiv ausfällt.
„Das fürchte ich auch. Aber wir haben mit unserem jetzigen Rechtsanwalt Thomas Hieber einen sehr kompetenten Mann. Warten wir es ab.“

Im neuen Europaparlament sitzen sehr viele europakritische Abgeordnete. Glauben Sie dennoch, dass das Parlament aufgeschlossen bleibt gegenüber Minderheitenfragen?
„Ich habe das Gefühl, dass der Nationalismus wieder aufblüht. Wenn das so ist, wird es schwierig für die Minderheiten. Sie müssen ja selbst national sein, das liegt in der Natur der Sache. Da liegt der Knackpunkt, denn das nutzen die Nationalisten, um zu sagen: Ihr seid ja auch national, warum dürfen wir es dann nicht sein? Das Problem der EU ist, dass sie eine Wirtschaftsgemeinschaft ist. Das Schlagwort von der Einheit in der Vielfalt bezieht sich nur auf die Wirtschaft. Die Subsidiarität, die immer gepriesen wurde, wird mit Füßen getreten. Die Entscheidungen sollten doch so nahe wie möglich am Bürger sein. Nur die großen Rahmen-Entscheidungen sollten bei der EU liegen. Das wurde aber nicht eingehalten.“
Das hat zu dem dramatischen Verfall des Images der EU beigetragen?
„Natürlich. Und es hat vor allem dazu geführt, dass sich die Völker nicht nähergekommen sind. Nur die Wirtschaft ist sich nähergekommen. Man hat immer gesagt: Wenn die Wirtschaft erst einmal läuft, dann sind die Verflechtungen so, dass es keinen Krieg geben kann. Aber das stimmt eben nicht. Das hat man jetzt mit Putin gesehen: Die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russland haben den Krieg nicht verhindert.“
Welche Zukunft sehen Sie für die FUEN?
„Ich bin grundsätzlich optimistisch. Aber ich bin auch so realistisch, dass ich sehen kann, die Zukunft wird schwierig. Und ich bin sehr in Sorge wegen eines anderen Trends, dem Verschwinden von Minderheiten. Ich sehe das auch in meiner Familie. Meine Frau – die aus Deutschland kommt – und ich, wir haben fünf Kinder. Aus verschiedenen Gründen hat es nur eines geschafft, seinen Kindern Deutsch und Dänisch weiterzugeben; diese sind zweisprachig. Im Falle unserer Minderheit kommt ja noch ein weiteres Problem dazu, dass nämlich die deutsche Minderheit als Umgangssprache vielfach einen dänischen Dialekt benutzt, Sønderjysk, also Südjütisch. Ein Professor, der in Kiel Historiker war, hat einmal gesagt: Ein deutscher Nordschleswiger ist einer, der auf Sønderjysk erklärt, warum er ein Deutscher ist. Ich habe in meiner Zeit als Hauptvorsitzender deshalb immer gesagt: Deutsch sprechen, denn die Sprache ist ein wesentliches Identitätsmerkmal.“
Das klingt eher pessimistisch.
„Kleine Minderheiten, solche in der Größe wie unsere in Nordschleswig, werden keine Chance haben zu überleben. Nur größere wie die deutschsprachige in Südtirol haben eine Chance.“