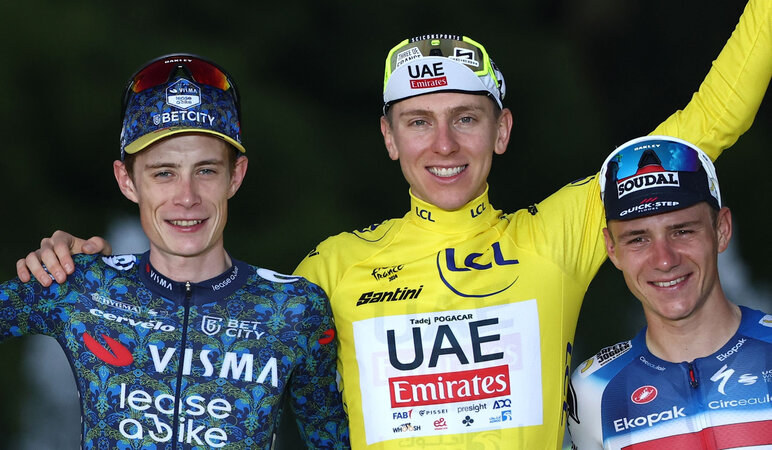Tour de France
Wie die Tour entstand und was sie so faszinierend macht
Wie die Tour entstand und was sie so faszinierend macht
Wie die Tour entstand und was sie so faszinierend macht

Diesen Artikel vorlesen lassen.
Teil 1: Die Tour de France ist neben den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft eines der größten Sportereignisse der Welt. Der nordschleswigsche Journalist Peter Kaadtmann begleitete für das „ZDF“ jahrelang die Tour und gibt im „Nordschleswiger“ einen Einblick in das Radrennen, das kommende Woche nach Nordschleswig kommt.
Frankreich - sind das nicht im Bewusstsein vieler Le Tour (de France) und La Tour (d'Eiffel), die berühmte Radrundfahrt und der nicht minder berühme Eiffelturm am Seine-Ufer im Herzen von Paris?
Beide ragen sie heraus aus so Vielem, das dieses Land prägt und so einmalig macht, und sie stehen als zwei bedeutende Symbole für L'Hexagone, das Sechseck, wie die Franzosen ihr Land gerne nennen.
Und beide sind sie im Kern Marketingprodukte. Während der Eiffelturm als Wahrzeichen der Weltausstellung 1889 wieder 1909 abgerissen werden sollte, aber als das markanteste Wahrzeichen der Hauptstadt blieb, war die erste Tour de France 1903 als Werbung für eine Zeitung gedacht.
Radrennen war ein Zufall
Es haperte mit der Auflage von L'Auto. Dessen Chefredakteur, Henri Desgrange, war der Meinung, es müsse etwas für die Steigerung der Verkaufszahlen getan werden. In kleiner Redakteursrunde brachte, eher spontan, weil unter Zeitdruck, Géo Lefèvre, einer seiner jungen Journalisten, die Idee einer Radrundfahrt durch ganz Frankreich ein.
Desgrange gefiel das, wohl nicht zuletzt, weil er selbst ein herausragender Radrennfahrer war, erster französischer Straßenmeister wurde und als ausgemachter Bahnspezialist neben vielen anderen Rekorden 1893 mit 35,325 km/h den ersten Stundenweltrekord aufstellte.
Neben der zweifellos journalistischen Herausforderung weckte der Vorschlag seinen Geschäftssinn in Erwartung eines mit mehreren Abenteuern verbundenes Radrennens quer durch Frankreich.
Etappe von 471 Kilometern
2.428 Kilometer in sechs (!) Etappen wurden 1903 gefahren, im Schnitt also 404 Kilometer pro Tag von Paris nach Lyon, weiter nach Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes und zurück nach Paris.
Die kürzeste Teilstrecke mit 268 Kilometern war immer noch länger als heutige, die längste war die Schlussetappe mit 471 Kilometer.
Der erste Sieger, der Franzose Maurice Garin brauchte rund 94 1/2 Stunden (der Zweite drei Stunden mehr). Klingt nach viel, bedeutet aber auf damaligen, gemessen am heutigen Standard primitiven Rädern auf zudem wenig geteerten, überwiegend schlechten Straßen, ein nahezu unvorstellbares Stundenmittel von 25,7 km/h.
Kratzende Wolle und kiloschwere Räder
Man schaue sich nur die Bilder von damals an: Die Herren im Rennanzug aus kratzender Wolle, mit großen Brusttaschen und kiloschwer, wenn sie vom Regen durchtränkt wurden.
Die Räder aus Stahlrohr mit Holzfelgen (!) wogen geschätzt bis zu 17 Kilogramm (heute die aus Carbon weit weniger als die Hälfte bei einer Untergrenze von 6,8 Kilogramm). Sie besaßen keinen Freilauf, sondern eine feste Übersetzung (wohl sehr nahe an 1:3), die mehr als kraftraubend ist.
Bergab musste man gegentreten, eine sogenannte Stempelbremse, die von oben auf den Reifen drückt, war – wenn überhaupt – nur am Vorderrad installiert. Wurde es irgendwann zu steil, drehte man das Hinterrad um, da dem normalen Zahnrad ein größeres, folglich mit kleinerer Übersetzung gegenüber befestigt war.
(Der Artikel geht unter der Faktenbox weiter)
Zweieinhalb Tage später...
60 Radfahrer waren am 1. Juli 1903, genau um 15.16 Uhr, gestartet. 12 Tage lagen vor ihnen, enthalten darin 7 Ruhetage. Zur ausreichenden Erholung? Wenn am Ende in Paris nur 21 ankamen?
Der letzte unter den Helden der ersten Tour brauchte gemessen an der Siegerzeit fast 65 Stunden mehr, also zweieinhalb Tage, als Garin.
Mit Josef Fischer, 1865 in Atzlern in der Oberpfalz geboren, war schon bei der Premiere einer von zwei deutschen Teilnehmern dabei. Er wurde 15. und brauchte gut 25 Stunden mehr als Garin.
Erfolg für L'Auto
Der angedachte Zweck wurde nicht verfehlt: L'Auto verzeichnete immense Auflagensteigerungen, hervorgerufen durch die täglichen Berichte von nahezu übermenschlichen Strapazen. Die Aufmerksamkeit war riesig: Menschen rannten vor ihre Häuser oder säumten schon damals zu Hunderttausenden die Strecken.
Und doch drohte der Tour ein Jahr später fast das Aus: Überfälle Maskierter auf Fahrer, Pistolenschüsse zu deren Vertreibung, Zug- und Automitfahrten, verbarrikadierte Straßen, Steinwürfe (weil ein Lokalmatador disqualifiziert wurde), Nägel auf der Strecke, einem Fahrer wurde das Rad zusammengetreten.
Wenn ich nicht ermordet werde, gewinne ich.
Maurice Garin, Sieger auch 1904, später im Jahr wie die Zweiten bis Vierten wegen Betrugs disqualifiziert

Erste Krise im zweiten Jahr
Ein bitterer Kommentar zum heillosen, kinoreifen Durcheinander, bei dem allein 29 von 88 Startern gestrichen wurden. Entnervt und desillusioniert schrieb der Tourdirektor Henri Desgrange am 24. Juli 1904:
„Die Tour de France ist zu Ende, und ich fürchte, diese zweite Auflage war auch zugleich die letzte. Sie wird an ihrem Erfolg zugrunde gegangen sein, an der zerreißenden blinden Leidenschaft, an Beleidigungen und Verdächtigungen ignoranter und böser Zungen.“
Fast klingt das wie ein Menetekel, das die Tour de France in nunmehr 119 Jahren ihres Bestehens unablässig begleitet. Skandale aller Arten, die des Dopingmissbrauchs wohl am schwerwiegendsten.
Weil im Dunkeln die Mittel verabreicht werden, ist Leistung bei Lichte betrachtet Betrug. Am Konkurrenten, an Zuschauern – am Sport allgemein. Man staune etwa über den Satz, der kein moderner ist, aber ein solcher angesichts eines Jahrhunderts voller Skandale sein könnte – Desgrange schrieb ebenfalls 1904:
„Wir müssen den großen Kreuzzug für die Moral weitergehen und im Radsport aufräumen.“
Er war nicht nur ein Visionär, sondern im besten Sinne Moralist.
Betrüger an der Spitze
Verhindert hat seine frühe Mahnung weder sportliche Skandale noch immer wieder leichte bis schwere Dopingvergehen, dessen größtes das von Lance Armstrong ist, dem deshalb seine sieben Toursiege, den absolut meisten vor den jeweils fünf von Anquetil, Merckx, Hinault und Indurain gestrichen wurden. Zu diesen Sündern zählen aus dänischer und deutscher Sicht auch die Toursieger Bjarne Riis (1996) und Jan Ullrich (1997).
Vorbilder, wie sie einst waren, die eine fantastische Radsportbegeisterung auslösten, sind sie nun nicht mehr.
Die ersten Bergetappen
Die Bergetappen, heute Höhepunkte enthusiasmierten Streckenpublikums und jeder Fernsehübertragung, gab es in den ersten Jahren noch nicht.
Alfonse Steinès konnte endlich im Januar 1909 trotz des anfänglichen Widerwillens von Desgranges, dann aber doch in dessen Auftrag, seine Idee umsetzen und die Pyrenäen nach befahrbaren Strecken erkunden – Strecken, die nichts anderes waren als primitive Bergpfade, Ziehwege, auf denen Bauern ihr Vieh trieben oder mit Holz und Heu beladenen Pferdekarren bewältigten.
Und die zu dieser Jahreszeit zudem noch völlig verschneit waren. Weil sich Steinès verirrte und die Nacht im Freien verbrachte, wäre er fast ums Leben gekommen. Und doch kabelte er: „Ich habe den Tourmalet passiert. Sehr gute Straße. Perfekt für Radsport.“
Spektakuläre Etappen
Eine dreiste Lüge öffnete den Weg für eine neues, spektakuläres Kapitel der Tour. 1910 waren an zwei Tagen elf Pyrenäenpässe zu bewältigen, in zwei Etappen, die erste 289 (!), die zweite 326 (!) Kilometer lang.
Octave Lapize geht in die Geschichte ein, weil er den ersten der beiden Teilabschnitte gewann. Auf Fotos ist zu sehen, wie er – noch mehr die schwächeren Konkurrenten – auf kaum befestigten Straßen zuweilen das Rad schieben musste.
Andere Bilder zeigen meterhohe Schneewände oder tief vermatschte Wege, die nur dürftig erahnen lassen, welchen Temperaturen, Winden und Regen die Fahrer ausgesetzt waren.
Am zweiten Tag, angeblich auf 2115 Metern Passhöhe des Tourmalet, heute der höchste asphaltierte Straßenpass der französischen Pyrenäen, reichte es dem 23-jährigen Franzosen: „Vous êtes des assassins. Oui, des assassins.“ (Ihr seid Attentäter. Ja, Attentäter!)
Überall lauern Berge
Die Pyrenäen, davor schon die Alpen, die Vogesen, das Zentralmassiv. Überall lauern Berge, die faszinierende Bilder liefern, die Legenden haben kommen oder fürchterlich scheitern sehen, an deren steilen Serpentinen abertausende Zuschauer schiebend, drängend, auf Tuchfühlung und außer sich den Spitzenfahrern nur kurzzeitig enge Gassen liefern, so als öffneten sich ihnen übergroße Mäuler und verschluckten sie im selben Moment, sie mit ihren Schreien schier nach vorne treiben, in glühender Hitze mit Wasser besprühen und manchmal ein wenig mit ihren Händen voran drücken.
Nichts ist spektakulärer als diese Bergpassagen, nicht die fulminanten Zielsprints, nicht die Fahrten durch die wunderbaren französischen Landschaften, auch die riskanten Abfahrten nicht.
Lapize gewann am Ende die 8. Tour de France. Am 14. Juli 1917, dem französischen Nationalfeiertag, starb er als freiwilliger Teilnehmer des 1. Weltkrieges nach Absturz seines Flugzeugs.

Der Tod auf dem Rad
Vergessen werden darf auch der Mont Ventoux nicht, dessen immenses, weißes Kalkschotterfeld oberhalb der Baumgrenze in der Provence heraussticht.
Durch Abholzung entstand eine unwirtliche Gipfelregion, an der sich zuweilen kältester Mistral austobt. Und doch kann es glühend heiß werden in dieser baumlosen Einöde, die so ist, wie man sich die Mondoberfläche vorstellt: Wie am 13. Juli 1967, dem Tag der 13. Etappe, als Tom Simpson zwei Kilometer unterhalb der Gipfelhöhe zusammenbricht und stirbt.
Da schon vor den Augen von Journalisten, den Objektiven von Foto- und Fernsehkameras. Dieses unmittelbare Dabeisein war schockierend und markiert einen der schlimmsten Etappentage.
Doping, Alkohol, Wassermangel
Im Doppelrausch hatte Simpson das Trinken vergessen. Der Körper kollabierte, weil die autonom geschützte Reserve ausgeschöpft war und damit die überlebenswichtigen Vitalfunktionen zusammenbrachen.
Halsbrecherisch – fast kann man es wörtlich nehmen – stürzen sich die Profis wie Hasardeure die Abfahrten hinab. Durchaus bis 100 km/h auf ihren superleichten Rennmaschinen. Dabei liegt die Bodenkontaktfläche der Reifen unter einem Quadratzentimeter. Manchmal zu wenig.
Am 18. Juli 1995 stürzt Fabio Casartelli schwer in enger Kurve und prallt gegen eine Betonbegrenzung. Ein Fahrfehler sicherlich, zu hohes Risiko ganz bestimmt. Ein tödliches für ihn.
Sicherheit war verpönt
Nicht zu vergessen: Damals fuhr man ohne Helm. Er war unter Profis geradezu verpönt. Erst acht Jahre später, 2003 – der Kasachstaner Kiwilew war bei Paris-Nizza ebenfalls ohne Helm zu Tode gekommen (zugleich zum 100-jährigen Jubiläum) – gilt vom Radweltverband verordnet die Helmpflicht.
Den beiden prominenten Verstorbenen wurden Denkmäler gesetzt. Sie hätten nicht sterben müssen.